
Uni-Spital setzt Patienten erstmals Schädeldecke aus dem 3D-Drucker ein
Baseljetzt
Dem Basler Uni-Spital gelingt eine Premiere. Es wurde erstmals einem Patienten eine künstliche Schädeldecke eingesetzt. Diese wurde in-house in einem 3D-Drucker produziert.
Es klingt nach Fiktion, ist aber Realität: Ende August ist es am Universitätsspital Basel erstmals gelungen, einem Patienten eine am USB selbst im 3D-Drucker produzierte Schädelplatte einzusetzen.
Das USB hat mehrere Jahre an der Innovation geforscht. Es ist das erste Spital in Europa, dem es gelungen ist, im 3D-Druckverfahren Implantate zu produzieren, wie das Uni-Spital in einer Mitteilung schreibt.
Genau auf den Patienten zugeschnitten
Beim Patienten handelt es sich um einen 46-jährigen Mann, der 2019 einen Schlaganfall erlitt. Die Schädeldecke, die zur Behandlung entfernt und wiedereingesetzt werden musste, begann sich nach einigen Monaten aufzulösen. Damit einher gingen starke Beschwerden und ein Einsinken des Schädels.
Der Leiter der Neurochirurgie, Prof. Raphael Guzman arbeitete in der Folge eng mit dem Projekt 3D-Implantatdruck und dem Team von Prof. Florian Thieringer, Chefarzt der Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie zusammen. Dem Team gelang es, eine künstliche Schädeldecke zu fertigen, die genau auf den Patienten zugeschnitten ist, den gesetzlichen Vorgaben entspricht und im Operationssaal eingesetzt werden konnte, wie es in der Mitteilung weiter heisst.
Grosse Vorteile
Seit dem erfolgreichen Eingriff sind erst ein paar Wochen vergangen. Der Patient sehe der Zukunft motiviert entgegen. Er wird von den Ärztinnen und Ärzten eng begleitet. Die Vorteile der Produktion im Haus seien für das USB gross. Einerseits können die Zwischenergebnisse während des gesamten Prozesses direkt mit allen Beteiligten abgeglichen werden, andererseits gibt es deutlich weniger Materialverluste.
Langfristig möchte das Unispital auch komplexere Implantate, beispielsweise für die Gesichtsrekonstruktion oder die Wirbelsäule, mittels 3D-Druck herstellen, wie das USB in der Mitteilung schreibt. «Das tolle Ergebnis bei unserem Patienten zeigt, dass sich die jahrelange Forschung gelohnt hat», sagt Prof. Florian Thieringer. (lfr/jwe)
Mehr dazu
Feedback für die Redaktion
Hat dir dieser Artikel gefallen?
Kommentare lesen?
Um Kommentare lesen zu können, melde dich bitte an.

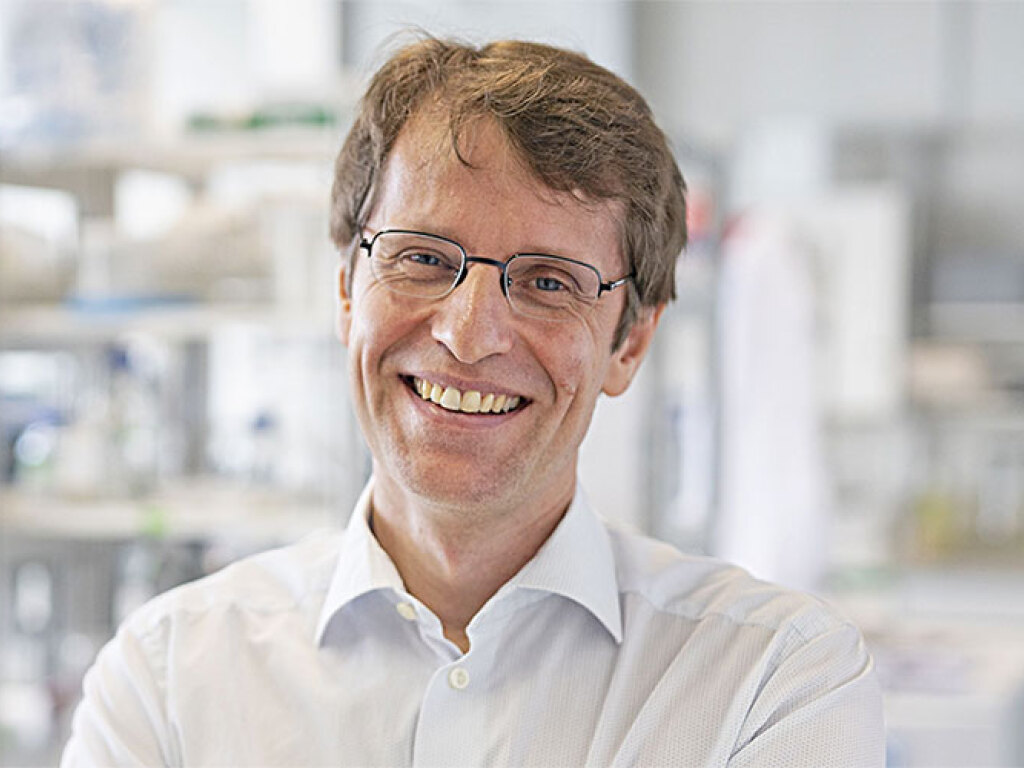

Kommentare
Dein Kommentar
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich mit der zweckgebundenen Speicherung der angegebenen Daten einverstanden. Datenschutzerklärung und Widerrufshinweise