
Weizenbier gegen Delir? Universitätsspital Basel testet neue Präventionsstrategie
Laura Pauli
Das Unispital Basel untersucht, ob Weizenbier Delirien bei Intensivpatient:innen vorbeugen kann. Gesponsert von «Unser Bier», soll die Studie eine alternative Präventionsstrategie zur Delirvermeidung bieten.
Seit Februar 2021 untersucht das Universitätsspital Basel in einer Studie, ob die Verabreichung von Weizenbier an Intensivpatient:innen zur Vorbeugung eines Delirs beitragen kann. Die Forschenden gehen der Hypothese nach, dass kleine Mengen Alkohol möglicherweise helfen, Delirzustände bei Patient:innen zu vermeiden, die regelmässig Alkohol in geringen Mengen konsumieren.
Sponsoring des Biers
Das in der Studie verwendete Bier wird von «Unser Bier» aus Basel gesponsert. Hochgerechnet handelt es sich um 150 Flaschen pro Jahr, wie Istvan Akos, Mitgründer von «Unser Bier», auf Anfrage von Baseljetzt erklärt. Das Bier ist biozertifiziert.
Kulturelle Trinkgewohnheiten und ihre Auswirkungen
Laut Chefarzt Martin Siegmund, Co-Leiter der Intensivstation und Leiter der Studie, trinken viele Patient:innen regelmässig geringe Mengen Alkohol, wie etwa ein Glas Wein zum Mittagessen. «Dieser gelegentliche Genuss gehört in weiten Teilen der Gesellschaft zur Kultur und hat oft nichts mit Abhängigkeit oder Alkoholismus zu tun», erklärt Siegmund.
«Wenn solche Patient:innen plötzlich auf die Intensivstation kommen, fehlt ihnen dieser regelmässige Alkoholkonsum. Und das könnte ein Faktor sein, der das Risiko eines Delirs erhöht», so Siegmund weiter. Für Patient:innen, die diese Angewohnheiten haben, könnte das plötzliche Fehlen von Alkohol eine psychische und physische Belastung darstellen, die die Wahrscheinlichkeit eines Delirs erhöht.
Ein Delirium, eine Form akuter Verwirrtheit, tritt bei Intensivpatient:innen häufig auf und kann durch zahlreiche Faktoren wie Medikamentenentzug, Schlafmangel, Alter und allgemeine Schwäche ausgelöst werden. Bei Patient:innen, die regelmässig Schlafmittel einnehmen, ist es üblich, diese auch auf der Intensivstation weiter zu verabreichen, um einem Delirium vorzubeugen. Schwieriger ist die Situation beim Alkohol: «Anders als bei Schlafmitteln geben Patient:innen auf der Intensivstation oft keine Auskunft über ihre Trinkgewohnheiten, weil sie befürchten, als alkoholabhängig eingestuft zu werden».
Verträglichkeit von Weizenbier auf der Intensivstation
Auf die Frage, ob es Fälle gibt, in denen Weizenbier schlecht vertragen wird, antwortet Siegmund: «Eigentlich nicht. Wenn es ein regelmässiges Problem wäre, würden wir es merken. Das Team achtet darauf, dass Patient:innen mit Magensonde nur geringe Mengen verabreicht werden, um Unverträglichkeiten zu vermeiden. «In seltenen Fällen können leichte Symptome wie Schwitzen auftreten, aber das erleben die Patient:innen auch bei gängigen Schmerzmitteln oder Schlafmitteln, die wir hier verwenden».
Sollte es dennoch zu Unwohlsein kommen, wird die Verabreichung gegebenenfalls angepasst. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die bisherige Verabreichung gut vertragen wird.
Auf der Suche nach Alternativen
Um diese Hypothese zu überprüfen, werden Patient:innen, die längere Zeit auf der Intensivstation verbringen und regelmässig kleine Mengen Alkohol zu sich nehmen, in die Studie aufgenommen. Sie erhalten abends entweder Wasser oder einen halben Liter Weizenbier – eine Dosis, die dem üblichen Alkoholkonsum nahe kommt und das Delirrisiko senken könnte.
«Ziel der Studie ist es nicht, Alkoholabhängigkeit zu fördern oder zu verharmlosen, sondern möglicherweise eine alternative Präventionsstrategie gegen Delirien zu finden», sagt Siegmund. Auch wenn der Ansatz nicht alle Delirien verhindern kann, könnte er eine wertvolle Ergänzung zu bestehenden Massnahmen darstellen.
«Wir wissen selbst nicht, wer Alkohol bekommt»
Auch wenn die Studie noch läuft, sind dank der sorgfältigen Planung erste verlässliche Daten zu erwarten: «Der Witz ist ja, dass wir eine Doppelblindstudie machen», erklärt Siegmund, «das heisst, die Flüssigkeit und die Verbindung zur Magensonde sind undurchsichtig – da ist eine schwarze Plastikfolie drum herum. So weiss niemand am Bett, weder der Arzt noch das Pflegepersonal, ob der Patient Alkohol bekommt». Diese Methode stellt sicher, dass niemand das Ergebnis der Behandlung voreingenommen beeinflussen kann.
Um die Objektivität zusätzlich zu gewährleisten, wird die Gruppe erst am Ende der Studie bekannt gegeben. «Auch bei der Auswertung sehen wir nur die Gruppen A und B, ohne zu wissen, welche die Alkoholgruppe ist. So vermeiden wir, unbewusst in die Ergebnisse hineinzuinterpretieren, was wir zu bestätigen hoffen». Auch die Statistikerin, die die Ergebnisse auswertet, kennt die Gruppenzugehörigkeit nicht.
Dieses strikte Vorgehen ist entscheidend, um die Ergebnisse wissenschaftlich belastbar zu machen. «Wenn wir nicht verblindet arbeiten und zum Beispiel wissen, dass eine Gruppe Bier bekommt, könnten wir unbewusst einen Bias haben – das wäre methodisch angreifbar», betont Siegmund. «Die Studie würde dann nicht als objektiv anerkannt und wäre kaum publizierbar.»
Neues und doch altbekanntes Gebiet
Der Versuch, Delirien auf Intensivstationen vorzubeugen, ist kein neues Forschungsfeld. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Studien, die medikamentöse Lösungen untersuchten – zum Beispiel durch den Einsatz von Neuroleptika oder Schlafmitteln. Doch diese Ansätze blieben meist erfolglos. «Eine wirksame medikamentöse Prophylaxe des Delirs gibt es nicht», erklärt Siegmund. «Medikamente, die speziell zur Delirprophylaxe entwickelt wurden, haben sich in der Praxis nicht bewährt.»
Erfolgreich sind dagegen pflegerische Massnahmen: Patient:innen werden regelmässig orientiert, erhalten Brillen und Hörgeräte, und das Pflegepersonal kommuniziert klar über Ort und Zeit, «dies auch, wenn sie nicht voll wach sind». Diese Massnahmen helfen, Orientierung und Ruhe zu fördern, was das Delirrisiko senken kann. Dennoch bleiben die Bedingungen auf der Intensivstation schwierig: ständiges Licht, Lärm und wenig Unterscheidung zwischen Tag und Nacht.
Sorgfältige Aufklärung und Einwilligung in die Studie
Da etwa 70 bis 75 Prozent der Intensivpatient:innen als Notfälle aufgenommen werden, ist es oft nicht möglich, sie im Vorfeld direkt über die Studie zu informieren. «Um sicherzustellen, dass nur geeignete Patient:innen teilnehmen, wird deshalb ein unabhängiger Arzt hinzugezogen, der weder auf der Intensivstation angestellt ist noch mit der Studie in Verbindung steht», erklärt Siegmund. Dieser prüft, ob es Gründe gibt, die gegen eine Teilnahme sprechen, zum Beispiel eine Alkoholkrankheit oder religiöse Überzeugungen, die den Alkoholkonsum ablehnen würden.
Anschliessend werden die Angehörigen befragt, ob sie glauben, dass der Patient einer Teilnahme zugestimmt hätte. «Wenn die Angehörigen sagen, dass der Patient mitgemacht hätte, führen wir die Studie durch. Sobald die Patient:innen auf dem Weg der Besserung sind, wird direkt ihr Einverständnis zur Verwendung der erhobenen Daten eingeholt. «Wenn sie wieder gesund sind, können sie selbst sagen, ob sie wollen, dass wir ihre Daten für die Studie verwenden», so der Sprecher weiter. Die meisten hätten wenig Einwände: «Man trinkt zu Hause auch mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier. Das finden die Leute meist weniger problematisch als ein neues Medikament.
Zukunft der Studie
«Wir müssen die Ergebnisse immer verallgemeinern», erklärt Siegmund, «wenn es bei uns funktioniert, heisst das noch lange nicht, dass es auch in Kopenhagen oder Zürich funktioniert. Um das zu klären, ist eine grössere Studie mit mehreren Zentren geplant, um die Wirksamkeit von Weizenbier zu überprüfen, wenn sich die Hypothese bestätigt.
Sollte sich der positive Effekt bestätigen, könnte eine routinemässige Gabe bei Intensivpatient:innen mit hohem Delirrisiko sinnvoll sein. «Gerade bei Patient:innen, die wir nicht befragen können, wäre es denkbar, ihnen regelmässig etwas über die Magensonde zu verabreichen, sofern keine schweren Darmerkrankungen vorliegen», sagt Siegmund. «Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Ansatz in Zukunft zur Standardtherapie werden könnte.» Die Studie läuft noch bis 2027.
Mehr dazu
Feedback für die Redaktion
Hat dir dieser Artikel gefallen?
Kommentare
Dein Kommentar
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich mit der zweckgebundenen Speicherung der angegebenen Daten einverstanden. Datenschutzerklärung und Widerrufshinweise
Kommentare lesen?
Um Kommentare lesen zu können, melde dich bitte an.


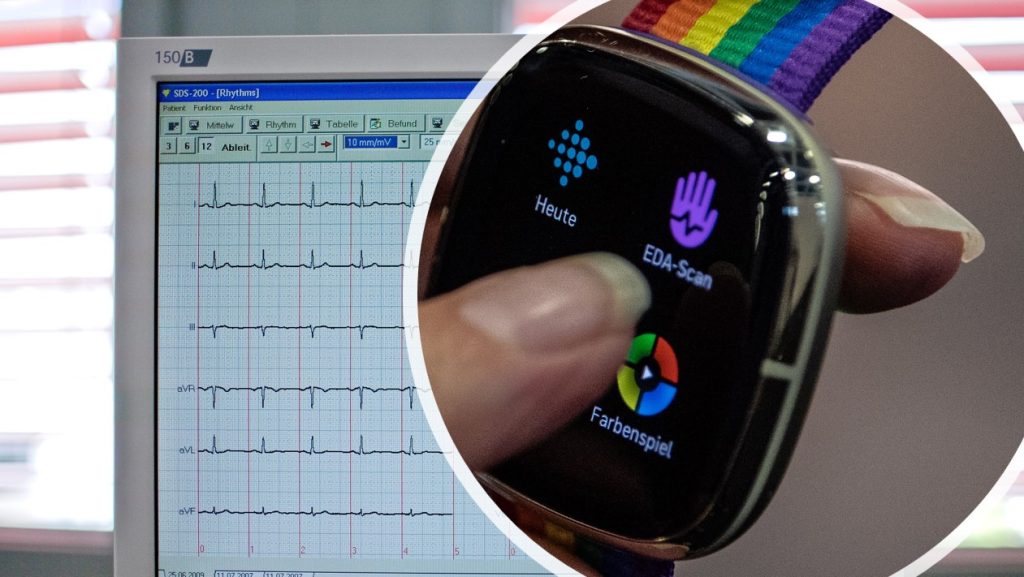
MatthiasCH
Igitt, warum ausgerechnet Weizenbier? Da wäre mir Amber lieber
spalen
weizenbier als heilmittel! spannende perspektive